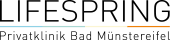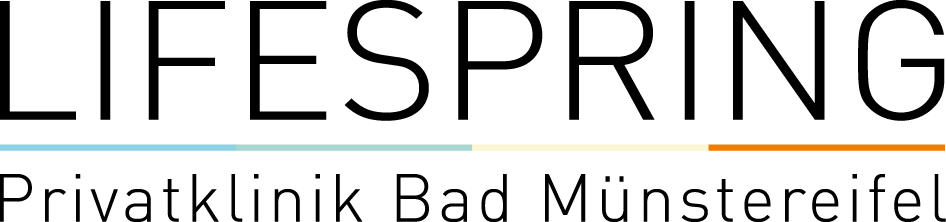Symptome, Entzugserscheinungen, Nebenwirkungen, Schmerzen und Opioid-Entzugssyndrom?
Haben sich Körper und Psyche über einen längeren Zeitraum hinweg an den Konsum eines bestimmten Suchtstoffs gewöhnt, kommt es bei einem Entzug teils zu drastischen Nebenwirkungen und Schmerzen. Das gilt besonders beim Opiat-Entzug: Haben der Inhaltsstoff Morphin (auch Morphium genannt) beziehungsweise eins seiner halb- oder vollsynthetischen Derivate bislang dafür gesorgt, dass sowohl seelische als auch körperliche Schmerzen wirksam in Schach gehalten werden, muss der Entzugsbetroffene jetzt ohne diese „Unterstützung“ zurechtkommen. Infolgedessen treten bei einem Entzug (oder auch bei zunächst durchgeführter Reduktion) von Opiaten diverse Symptome, Entzugserscheinungen und Nebenwirkungen auf. Je nach Schwere der Abhängigkeit, nach Arten von eventuellem Bei- bzw. Mischkonsum sowie nach individueller Verfassung können sie in ihrer Ausprägung von Mensch zu Mensch verschieden sein. Begrifflich zusammengefasst werden sie unter dem Opioid-Entzugssyndrom. Darunter fallen leichtere sowie stärkere Symptome, die im Falle einer Nichtbehandlung auch lebensbedrohlich werden können:
- Leichtere Symptome, wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, innere Unruhe, laufende Nase, Tränenfluss, erweitere Pupillen
- Stärkere Symptome, wie Schlafstörungen, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Muskelschmerzen- und krämpfe, Bluthochdruck, Herzrasen, Fieber, Angstzustände, Depressionen
Typisch für jede Art von Suchtmittelentzug und somit auch für den von Opiaten ist das sogenannte „Craving“, das während des gesamten Entzugsverlaufs und auch danach immer wieder vorkommt. Darunter wird das starke Verlangen nach erneutem Konsum des Suchtmittels verstanden. Diesen psychischen Druck gilt es während des Entzugs und der begleitenden Psychotherapie zu kontrollieren und dementsprechende Verhaltensregeln zu erlernen.
Eine weitere und häufige Erscheinung beim Opioid-Entzug ist die verstärkte Wahrnehmung von Schmerzen (Hyperalgesie). Da das Opioid bisher dafür gesorgt hat, dass ebendiese Schmerzen deutlich vermindert bis gar nicht mehr wahrgenommen werden, geschieht beim Absetzen des Stoffes konsequenterweise nun das genaue Gegenteil. Bis sich der Körper wieder an ein „normales“ Schmerzempfinden gewöhnt hat, das nicht künstlich unterdrückt wird, nimmt der Betroffene gerade zu Beginn des Entzugs Schmerzen besonders deutlich wahr.
Was bedeutet „Kalter Entzug“?
Unter einem kalten Opiatentzug versteht man das abrupte Absetzen des Suchtmittels, ohne es zunächst kontrolliert zu reduzieren sowie auftretende Entzugssymptome zu behandeln. Häufig versuchen Betroffene diesen Schritt auf eigene Faust zu gehen, um sich weder Ärzten noch der eigenen Familie oder Freunden gegenüber als suchtkrank offenbaren zu müssen. Zu Hause und ohne professionelle Unterstützung verzichten sie meist vom einen auf den anderen Tag auf den Opiatkonsum. Nicht zuletzt aufgrund des Erleidens drastischer Entzugserscheinungen kommt es – nachweislich – in sehr vielen dieser Fälle nach kurzer Zeit wieder zum Rückfall.
Aus diesen Gründen ist von einem kalten Entzug dringend abzuraten. Zum einen benötigt ein Betroffener gerade die Unterstützung und Motivation von Familie oder Freunden, zum anderen ist ein Entzug unter ärztlicher Aufsicht deutlich erträglicher. Denn durch die Einnahme unterstützender Medikamente (z.B. Substitution mittels Methadon) lassen sich die meisten der auftretenden Entzugssymptome spürbar reduzieren. Dadurch steigt die Chance auf Vollendung des Entzugs erheblich.
Mit welchen Medikamenten und Hilfsmitteln lassen sich Entzugserscheinungen lindern?
Gerade bei Betroffenen, die schon lange und in hohen Dosen Opiate konsumieren, findet vor dem eigentlichen Entzug oftmals eine Substitutionsbehandlung statt. In der Regel wird dann statt des bisher eingenommenen Präparats Methadon oder Buprenorphin verabreicht, um die Entzugssymptome auf diese Weise zu lindern. Langfristiges Ziel ist aber auch in diesem Fall natürlich die dauerhafte Abstinenz.
Gleichzeitig können die typischen Entzugserscheinungen medikamentös behandelt werden. Dabei kommen häufig Antidepressiva und Neuroleptika zum Einsatz. Unter ärztlicher Kontrolle wird der Betroffene dadurch beim Entzug unterstützt: Denn je erträglicher der Entzug verläuft, desto höher sind die Aussichten, durchzuhalten und auf Opiate verzichten zu können!
Während eines qualifizierten Entzugs, der aus oben genannten Gründen dringend in einer Fachklinik oder einem Krankenhaus unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden sollte, kommen außerdem weitere begleitende Maßnahmen zum Einsatz: Musik-, Bewegungs- und Sporttherapien zählen ebenso dazu wie die Psychotherapie im Einzel- und Gruppensetting. Hierbei geht es darum, sich mit den Gründen für die eigene Suchterkrankung auseinanderzusetzen und zu lernen, wie man den „Griff zur Droge“ in Zukunft vermeiden kann. Sportliche Aktivitäten sowie ein geregelter Tagesablauf sorgen gleichzeitig dafür, seine Zeit sinnvoll zu nutzen und eine gesunde Alternative für die eingeschliffenen Suchtstrukturen anzubieten.
Welche Erfahrungen gibt es zum Opiatentzug: besser zu Hause oder in der Klinik?
Wer auf der Suche nach diversen Erfahrungen anderer Suchtkranker bezüglich eines Opiatentzugs ist, wird in Internetforen (z.B. suchtundselbsthilfe.de, forum.netdoktor.at) schnell fündig. Hier findet man sowohl positive als auch negative Fallbeispiele: einige, die direkt nach dem ersten Entzug abstinent waren; andere, die wiederum mehrere Anläufe brauchten, und auch Betroffene, die sich durch einen kalten Entzug gequält haben – und dringend davon abraten. Ein gutes Beispiel stammt von always trying to stop aus dem Netdoktor-Forum:
„Während ich meine ersten Entzüge noch locker weggesteckt habe, wird es jetzt immer schlimmer! Daher lasse ich mich jetzt mit Polamidon substituieren und das würde ich auch allen Süchtigen raten, da diese Substanz i.A. gut verträglich ist und die Reduktion zum Aushalten ist – im Gegensatz zu einem kalten Entzug!!“.
Sicher lassen sich gerade im Internet auch einige Betroffene ausfindig machen, die von einem erfolgreichen Entzug zu Hause berichten. Doch muss aus medizinischer Sicht in den allermeisten Fällen dringend davon abgeraten werden. Wer langfristig vom Opiat loskommen und den Entzug so erträglich wie möglich hinter sich bringen möchte, sollte dringend das Gespräch mit dem Hausarzt oder einer Suchtberatungsstelle suchen. Gemeinsam werden dann die nächsten Schritte für einen professionellen Entzug in einer Fachklinik bzw. im Krankenhaus vorbereitet.
Wie lange dauert der Opiatentzug?
Die Dauer eines Opiatentzugs lässt sich nicht pauschal festlegen. In der Regel muss mit einer Gesamtdauer von mehreren Wochen bis Monaten gerechnet werden, um eine solide Basis für ein langfristiges Leben ohne Opiatabhängigkeit schaffen zu können. Wie viel Zeit das aber genau in Anspruch nimmt, hängt nicht nur von der Schwere der Sucht ab oder vom Beikonsum und dem Vorliegen eventueller Begleitkrankheiten (z. B. HIV, Hepatitis), sondern ganz besonders auch davon, wie die einzelnen Schritte des Entzugs gemeistert werden.