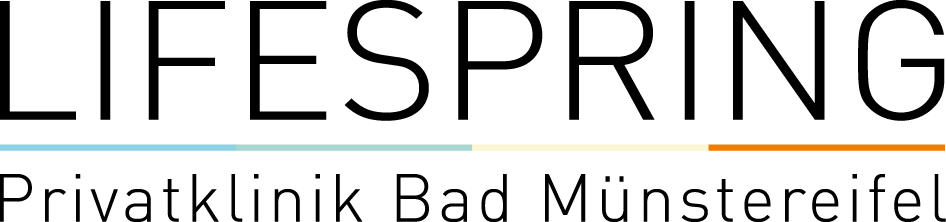Viele Menschen verbinden mit dem Verzehr von Alkohol ein positives Geschmackserlebnis. Deshalb werden zum Beispiel Bier, Wein, Sekt, Cocktails, Mixgetränke, Shots und Spirituosen quer durch alle Schichten und Altersklassen gerne getrunken. Es ist aber noch etwas anderes, was ihn – zumindest in Deutschland – zur Genussdroge Nr. 1 macht: seine als anregend, enthemmend und stimmungsaufhellend bis euphorisierend empfundene Wirkung. Umso verständlicher ist es, dass jemand, der unter den Auswirkungen einer Depression leidet, zu dieser verlockenden Möglichkeit der „Selbstmedikation“ greift. Denn Alkohol ist einfach verfügbar und wirkt schnell. Doch gerade dieser rasch einsetzende Kick macht ihn für suchtgefährdete Menschen gefährlich. Sie sind nämlich für die Entwicklung eines zwanghaften Verlangens nach diesem Kick (craving) besonders empfänglich. Es stellt sich daher die Frage: Eröffnet der Verzehr von Alkohol im Sinne einer Selbstmedikation wirklich einen empfehlenswerten Weg aus der Depression?
Was ist eine Depression?
Eine Depression äußert sich in Krankheitszeichen, die bei vielen Menschen bisweilen schon einmal vorkommen. Dies macht es schwierig, eine Depression zu erkennen und zu diagnostizieren. Im Vordergrund stehen überwiegend: eine gedrückte Stimmung, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit und negative Gedanken – auch hinsichtlich der Zukunft. Ebenso sind innere Leere, ein generelles Desinteresse, Freudlosigkeit und sozialer Rückzug charakteristische Erscheinungen einer Depression. Hinzu kommen sehr häufig ein allgemeiner Antriebsmangel sowie eine schnelle Ermüdbarkeit, die oft schon nach kleinen Anstrengungen einsetzt. Diese Hauptsymptome können zudem noch begleitet werden von: Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, nachlassender Konzentrations- und Entscheidungsfähigkeit, einem geringen Selbstwertgefühl und Schuldgefühlen. Bei schwerem und/oder unbehandeltem Verlauf einer Depression können sich schließlich sogar Selbsttötungsgedanken einstellen. Das Risiko, dass in solchen Fällen aus Denken auch Handeln wird, ist keineswegs hypothetisch, sondern eine reale Gefahr. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang unsere Hinweise für eine Notfallhilfe bei akuter Gefährdung. Sie finden sich am Ende dieses Beitrags!
Ärztliche Abklärung angeraten
Bei der Frage, ob es sich beim Auftreten der gerade geschilderten Symptome wirklich um eine Depression handelt, spielen unter anderem eine Rolle: die Dauer und Häufigkeit dieser Erscheinungen sowie die Lebensumstände. Angenommen zum Beispiel, eine depressive Episode hält über mehrere Wochen an und/oder tritt wiederholt auf. Die konkreten Lebensumstände liefern hierfür aber keinen erkennbaren Grund.[1] In einem solchen Fall wäre eine ärztliche Abklärung dringend angeraten. Denn zum einen ist ein möglichst früher Einstieg in die Behandlung wichtig, damit es zu einer chronischen Ausprägung oder Selbsttötungsgedanken erst gar nicht kommt. Zum anderen gilt es aber auch auszuschließen, dass nicht andere Erkrankungen mit ähnlicher Symptomatik hinter den Beschwerden stecken.
Im Rahmen der ärztlichen Abklärung wird bei der Erhebung der Krankenvorgeschichte (Anamnese) unter anderem auch nach den Trinkgewohnheiten gefragt. Denn eins sei hier bereits vorweggenommen: Depressive Verstimmungen bis hin zum vollen Krankheitsbild der Depression zählen zu den häufigsten Begleit- und Folgeerscheinungen eines problematischen bis suchtgesteuerten Alkoholkonsums.
Wie wirkt Alkohol in diesem Zusammenhang?
Man geht heute davon aus, dass bei depressiven Menschen die Konzentration bestimmter Botenstoffe in den Gehirnzellen geringer ist als bei Nicht-Depressiven. Bei diesen Botenstoffen handelt es sich um Serotonin, Noradrenalin oder Dopamin. Auch ein Endorphin-Mangel steht im Verdacht, die Ausprägung einer Depression zu begünstigen. Die genannten Botenstoffe nehmen im menschlichen Organismus zwar zahlreiche Aufgaben wahr. Bekannt sind sie aber vor allem für ihre Funktion im Hinblick auf Stimmung, Angstempfinden oder Antrieb. Sie werden im Volksmund deshalb auch als „Glückshormone“ bezeichnet. Diesen Zusammenhang machen sich moderne Anti-Depressiva, wie zum Beispiel Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) oder Selektive Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (NARI) zu nutzen. Denn sie erhöhen die Verfügbarkeit dieser Stoffe in den Gehirnzellen, so dass dort möglichst wieder ein normaler Level an diesen Hormonen herrscht.
Neuere Untersuchungen legen nahe, dass Alkohol aktivierend auf die Andockstellen (Rezeptoren) dieser „Glückshormone“ an den Gehirnzellen wirkt. Dadurch können die Zellen mehr dieser Botenstoffe aufnehmen, was dort ebenfalls zu einer höheren Verfügbarkeit und Konzentration führt. Insgesamt sind die hiermit verbundenen Prozesse recht komplexe Kettenreaktionen, bei denen man noch nicht alle „Glieder“ verstanden hat. Dennoch scheint in diesem Zusammenhang die Wirkung des Alkohols – zumindest im Ergebnis – ähnlich zu sein wie bei den modernen Antidepressiva.
Probleme bei der antidepressiven „Selbstmedikation“ mit Alkohol
Allerdings handelt man sich eine Reihe an Problemen ein, wenn man Alkohol in diesem Sinn als antidepressiv wirkendes „Medikament“ missbraucht. In den folgenden Abschnitten werden diese Probleme beschrieben.
Alkohol stört Gleichgewicht zwischen stimulierenden und hemmenden Stoffen
Die Wirkung des Alkohols unterscheidet sich deutlich in Abhängigkeit der jeweils aufgenommenen Menge und dadurch erreichten Konzentration im Körper. Stimulierend wirkt er nur in geringer Dosierung. Bereits bei mittleren und erst recht bei höheren Dosierungen überwiegt zunehmend sein hemmender Effekt. Dies hängt damit zusammen, dass Alkohol nicht nur die Aufnahmefähigkeit der Glückshormone in den Gehirnzellen erhöht. Er aktiviert auch bestimmte Teile des GABA-Systems. Dieses Botenstoff-System fungiert als wichtiges Gegenregulativ im Körper. Denn es wirkt wie eine Bremse (=hemmend), um zum Beispiel überschießende Reaktionen anderer Systeme zu verhindern. Das durch das GABA-System eigentlich angestrebte Gleichgewicht zwischen stimulierenden und hemmenden Stoffen wird durch die unterschiedlichen Wirkungen des Alkohols aus der Balance gebracht.
Keine standardisierte Wirkstoffmenge im pharmakologischen Sinn
Bei einem offiziell zugelassenen Medikament kann man sich als Patient darauf verlassen, dass in jeder Tablette exakt die auf der Verpackung angegebene Wirkstoffmenge enthalten ist. Außerdem wird jedes zulassungspflichtige Arzneimittel auf dem Weg zur Marktreife umfangreich auf Verträglichkeit und Nebenwirkungen hin überprüft. All das ist bei alkoholischen Getränken nicht der Fall. Denn deren Zutaten, Herstellung und Weiterverarbeitung ist so variantenreich, wie das Sorten-Angebot und der jeweilige Promillegehalt. Mit einem pharmakologisch standardisierten Verfahren hat das nichts zu tun. Hiermit ist keineswegs ein Vorwurf an Brauereien, Brennereien oder Kellereien verbunden. Denn die dort hergestellten Produkte sind ja auch nicht für medizinische Verwendungszwecke gedacht. Fakt ist aber: Eine gleichbleibende Dosierung der Wirkstoffmenge beim Verzehr alkoholischer Getränke ergibt sich – wenn überhaupt – höchstens zufällig. Das macht die Wirkung von Alkohol, wenn man ihn – gewissermaßen – als Medikamentenersatz missbraucht, höchst unberechenbar. Außerdem bringt diese Unberechenbarkeit auch ein hohes Entfaltungsrisiko für die toxischen Nebenwirkungen des Alkohols mit sich.
Hohes Sucht- und Abhängigkeitspotenzial
Alkohol birgt aufgrund seiner rasch anflutenden Wirkung, seiner schnell einsetzenden Toleranzentwicklung und seiner Entzugsproblematik ein hohes Sucht- und Abhängigkeitspotenzial. Für eine „Langzeitanwendung“ ist er daher vollkommen ungeeignet. Das ist bei modernen Anti-Depressiva anders. Es kann zwar nach längerer Einnahme beim zu plötzlichen Absetzen eines Anti-Depressivums zu vorübergehenden Absetzerscheinungen kommen. Aus diesem Grund wird beim Absetzen dieser Medikamente immer zu einer ausschleichenden Vorgehensweise geraten. Anti-Depressiva machen aber – im Gegensatz zu Alkohol – nicht abhängig oder süchtig.
Wirkumkehr des Alkohols bei hoher Dosis und chronischem Konsum
Jeder, der schon einmal Alkohol „über den Durst“ getrunken hat, kennt den berüchtigten „Hangover-Effekt“ am Morgen danach. So wird die von einer niedergedrückten Grundstimmung geprägte Erholungsphase nach einer durchzechten Nacht bezeichnet. In der Tat kommt es in solchen Fällen zu einer Art Wirkumkehr des Alkohols. Denn der durch das vorangehende und „hochdosierte“ Trinken aus dem Gleichgewicht gebrachte Botenstoffwechsel im Gehirn benötigt eine gewisse Zeit zur Normalisierung.
Wichtig: Diese Wirkumkehr tritt sehr häufig auch bei chronischem Alkoholkonsum in höheren Dosen auf. Infolgedessen kann sich in diesen Fällen auf längere Sicht eine Depression entwickeln. Wenn man also regelmäßig zur Flasche greift, um die Beschwerden einer bereits vorher schon vorliegenden Depression zu lindern, sollte man sich eins klar vor Augen halten: Das, was mit dem Griff zur Flasche eigentlich bekämpft werden soll, wird auf längere Sicht nicht gebessert, sondern sogar verschlechtert. Der Ansatz, Alkohol im Rahmen einer Selbstmedikation als „Anti-Depressivum“ zu missbrauchen, ist also – man muss es an dieser Stelle so klar zum Ausdruck bringen – vollkommen kontraproduktiv! Übrigens: Das gilt auch dann, wenn man bereits eins der oben angesprochenen Anti-Depressiva einnimmt. Denn ein regelmäßiger und hoher Alkoholkonsum mindert deren Wirksamkeit, während ihr Nebenwirkungsrisiko zunimmt.
Welcher Weg ist der bessere aus einer Depression?
Dies führt zu der Frage: Welcher Weg ist der bessere aus einer Depression? Eine empfehlenswertere Behandlungsoption als Alkohol stellen – nach vorausgegangener sorgfältiger Diagnose – die Gabe von anti-depressiv wirkenden Medikamenten und/oder die Aufnahme einer Psychotherapie dar. Eine Liste mit in Deutschland oft verschriebenen Antidepressiva findet sich unter „Antidepressiva – eine Übersicht“. Für eine Psychotherapie kommen zum Beispiel eine (kognitive) Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, interpersonelle Therapie (ITP) oder eine tiefenpsychologisch ausgerichtete Behandlung in Betracht. Sie werden von entsprechend qualifizierten ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten angeboten. Komplementäre Therapieangebote (z. B. Kunst-, Musik- und Bewegungstherapie) können die Behandlung hilfreich und wirkungsvoll unterstützen.
Übrigens: Bei nur leicht ausgeprägten Depressionen kommt es nach drei bis sechs Monaten häufiger von selbst zu einer deutlichen Besserung der Beschwerden. Dies zur Ermutigung! Insofern können auch etwas Geduld und Nachsicht mit sich selbst aus einer Depression herausführen.
Und im Notfall?
Als erste Anlaufstelle in Notfällen (z. B. bei akuter Suizidgefahr) stehen z. B. psychologisch-psychiatrisch ausgerichtete Notfallambulanzen in örtlichen Krankenhäusern oder auch die Telefonseelsorge zur Verfügung. Das Onlineportal des Netzwerks „Telefonseelsorge“ ist aufrufbar unter https://www.telefonseelsorge.de/. Dort finden Sie bundesweit gültige Telefonnummern, die Möglichkeit zur Online-Beratung sowie eine Suchmaschine für Anlaufstellen vor Ort. Übrigens: Die Beratungsangebote gewährleisten selbstverständlich absolute Vertraulichkeit sowie die Wahrung Ihrer Anonymität. Außerdem sind sie im 24h-Dienst verfügbar, kostenfrei und auf schnelle Hilfeleistung eingerichtet.
[1] Ein erkennbarer Grund im Bereich der Lebensumstände wäre zum Beispiel ein Trauerprozess im Zusammenhang mit dem Verlust einen nahen Angehörigen.